Tierarztpraxis in Ramersdorf – auch Hausbesuche.
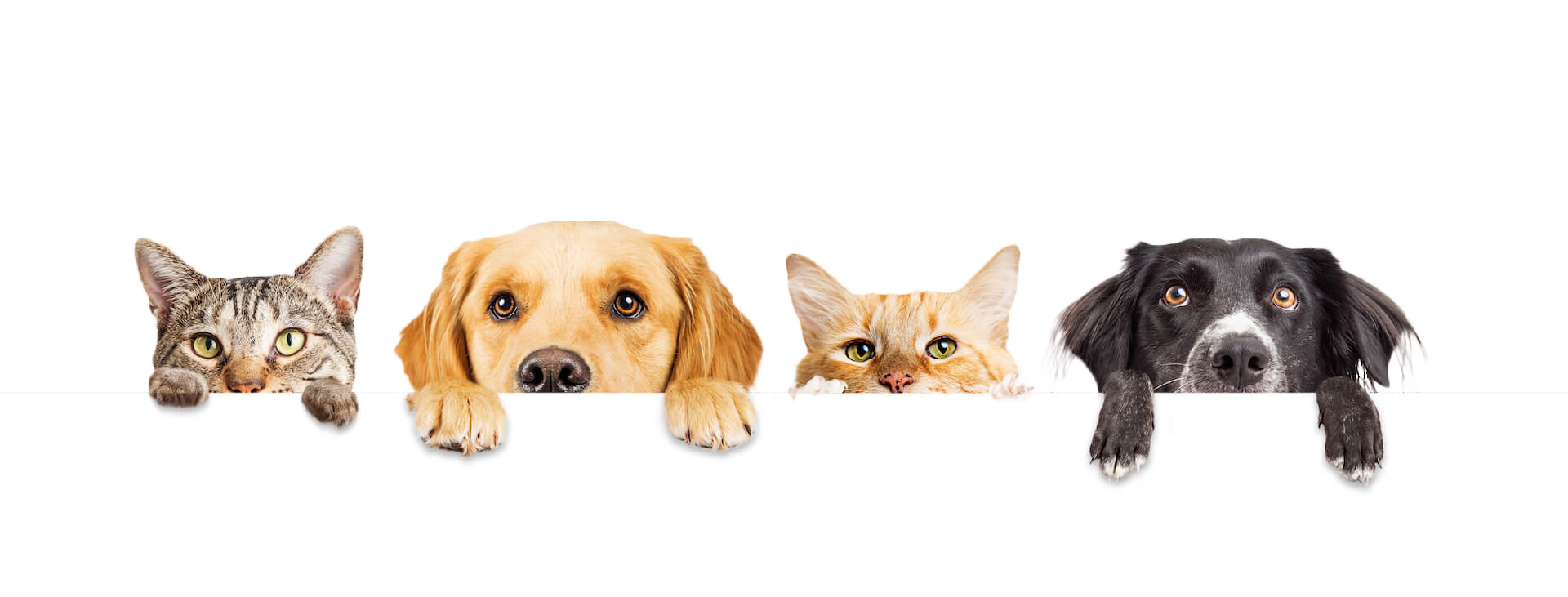
Hausbesuche für München und Umgebung.

Telefonnummer (auch im Notfall)
Liebe Tierhalter,
Herzlich Willkommen! Ob Sie nun einen Tierarzt in Ihrer Nähe suchen – wir sind im Osten von München, in Ramersdorf – oder ob Sie einige Themen zu Hund, Katze, Kaninchen, Meerschweinchen und anderen Heimtieren suchen, ich hoffe, Sie finden bei uns interessante Informationen, Tipps und Adressen.
Terminvereinbarung
Praxistermine in Ramersdorf können über dieses Formular angefragt werden.
Hausbesuche bitte per Mail oder telefonisch anfragen.
Telefonnummer (auch im Notfall)
Liebe Tierhalter,
Herzlich Willkommen! Ob Sie nun einen Tierarzt in Ihrer Nähe suchen – wir sind im Osten von München, in Ramersdorf – oder ob Sie einige Themen zu Hund, Katze, Kaninchen, Meerschweinchen und anderen Heimtieren suchen, ich hoffe, Sie finden bei uns interessante Informationen, Tipps und Adressen.
Terminvereinbarung
Hausbesuche können nur nach telefonischer Terminvereinbarung stattfinden.
Kundenstimmen
“Immer wieder gerne. Also hoffentlich nicht :-). Aber wenn, rufe ich auf jeden Fall wieder bei Alexandra Häckel an.”
“Mein Hund Sammy wurde schnell wieder gesund. Dank der Hilfe von Alexandra. Danke Dir :-).”
“Kompetent, sympathisch, freundlich und schnell zu Stelle. Danke sehr.”
Tierärztin Alexandra Häckel in München-Ramersdorf
Für eine Terminvereinbarung rufen Sie mich bitte in den Sprechzeiten meiner Tierarztpraxis an. Die Öffnungszeiten meiner Praxis finden Sie in der mittleren Spalte.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, wenn sich die Mailbox einschaltet. Diese schaltet sich ein, wenn ich gerade in einer Behandlung bin.
Hinterlassen Sie bitte Ihren Namen und Ihre Telefonnummer und ich rufe sie dann schnellstmöglich zurück.
Falls Sie wünschen, dass ich zu Ihrem Haustier nach Hause kommen, dann bitte auch vorher telefonisch einen Termin vereinbaren.
Rufen Sie mich gerne an
Öffnungszeiten:
Mo und Mi 9:30-12:00 | 14:00-17:00
Di geschlossen
Do 15:00-18:00
Fr 09:00-13:00
Gemeinsam mit Ihnen die bestmögliche Versorgung Ihres Tieres zu erreichen, das ist unser Ziel.
Häufig erlaubt dem Tierarzt erst eine genaue Diagnose Auskunft darüber, wie der Krankheitsverlauf sein wird und welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt. Neben dem wichtigen Vorgespräch und einer gründlichen Untersuchung stehen dazu in unserer Praxis moderne Geräte zu Verfügung.
Laboruntersuchungen, Röntgen, Ultraschall und Blutdruckmessungen sind wichtige Hilfsmittel. Zur Zahnbehandlung stehen eine spezielle digitale Röntgeneinrichtung sowie spezielle Geräte, auch für kleine Heimtiere zur Verfügung.
Tierarztpraxis in München-Ramersdorf
Lieber Tierhalter,
ob Sie nun einen Tierarzt in Ihrer Nähe suchen – wir sind im Osten von München, in Ramersdorf – oder ob Sie einige Themen zu Hund, Katze, Kaninchen, Meerschweinchen und anderen Heimtieren suchen, ich hoffe, Sie finden bei uns interessante Informationen, Tipps und Adressen.
Rufen Sie mich gerne an
Öffnungszeiten:
Mo+Mi 09:30-12:00
Mo+Mi 14:00-17:00
Di geschlossen
Do 15:00-18:00
Fr 09:00-13:00
Gemeinsam mit Ihnen die bestmögliche Versorgung Ihres Tieres zu erreichen, das ist unser Ziel. Häufig erlaubt dem Tierarzt erst eine genaue Diagnose Auskunft darüber, wie der Krankheitsverlauf sein wird und welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt. Neben dem wichtigen Vorgespräch und einer gründlichen Untersuchung stehen dazu in unserer Praxis moderne Geräte zu Verfügung.









